V: Hans Winterberg – Sonata No. 5 (1950)
Bitte wählen Sie einen Titel, um hineinzuhören

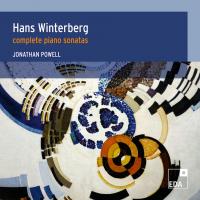 I: Hans Winterberg – Sonata No. 1 (1936)
I: Hans Winterberg – Sonata No. 1 (1936)I: Hans Winterberg – Sonata No. 1 (1936)
01 Agitato
I: Hans Winterberg – Sonata No. 1 (1936)
02 Adagio
I: Hans Winterberg – Sonata No. 1 (1936)
03 Molto vivace
II: Hans Winterberg – Sonata No. 2 (1941)
04 Agitato
II: Hans Winterberg – Sonata No. 2 (1941)
05 Andante sostenuto
II: Hans Winterberg – Sonata No. 2 (1941)
06 Molto vivace
III: Hans Winterberg – Sonata No. 3 (1947)
07 Molto vivace
III: Hans Winterberg – Sonata No. 3 (1947)
08 Molto adagio
III: Hans Winterberg – Sonata No. 3 (1947)
09 Vivace
IV: Hans Winterberg – Sonata No. 4 (1948)
10 Allegro con moto
IV: Hans Winterberg – Sonata No. 4 (1948)
11 Verhalten, ruhig
IV: Hans Winterberg – Sonata No. 4 (1948)
12 Allegro vivace
IV: Hans Winterberg – Sonata No. 4 (1948)
13 Äußerst bewegt
V: Hans Winterberg – Sonata No. 5 (1950)
14 Ruhig fließend
V: Hans Winterberg – Sonata No. 5 (1950)
15 Langsam
V: Hans Winterberg – Sonata No. 5 (1950)
16 Lebhaft, nicht zu schnell
V: Hans Winterberg – Sonata No. 5 (1950)
17 Allegro molto moderato
....................................................................................................
Nach Ersteinspielungen der Klaviersonaten Viktor Ullmanns und Norbert von Hannenheims (EDA 5, EDA 38) freuen wir uns sehr, dass die Funk Stiftung in Hamburg es uns ermöglicht, hier erstmals den vollständigen Sonaten-Zyklus Hans Winterbergs vorstellen zu können, eines Komponisten, der als Schüler Zemlinskys und Enkelschüler Schrekers ebenfalls zum Umfeld der Zweiten Wiener Schule gehört. Mit Jonathan Powell konnten wir einen ausgewiesenen Experten für die Aufnahme der Klavierwerke Winterbergs gewinnen, die wir parallel zur Gesamteinspielung von dessen Kammermusik in Angriff genommen haben.
Fast sechzig Jahre liegen zwischen der ersten und letzten Komposition Hans Winterbergs – beides Klavierwerke –, der Toccata des 25-Jährigen von 1926 und den Drei Klavierstücken von 1984/85 des über 80-Jährigen. Angesichts dieser langen Zeitspanne mag es verwundern, dass seine fünf Klaviersonaten – Königsgattung der Klaviermusik vor allem im 19. Jahrhundert – im kurzen Zeitraum von nur vierzehn Jahren entstanden sind, zwischen 1936 und 1950, und die drei mittleren in den für Winterberg äußerst schwierigen Jahren 1941, 1947 und 1948. Dass er mit der fünften seinen Beitrag zur Gattung für abgeschlossen hielt, erklärt sich aus der Tatsache, dass er sich im Folgenden verstärkt anderen zyklischen Formen zuwandte, auf denen weniger "historisches Gewicht" lag, allen voran der Klaviersuite. Winterberg war offenbar ein hervorragender Pianist und es ist davon auszugehen, dass er sich seine Klavierwerke in die eigenen Finger schrieb. Er studierte Klavier ab dem Alter von neun Jahren bei der renommierten Prager Pianistin Therese (Terezie) Wallerstein, der Schwester des später berühmten Theaterregisseurs Lothar Wallerstein, bei der auch Hans Krása als Jugendlicher sein pianistisches Handwerk erlernte. Als Winterberg 1920 an der Deutschen Akademie für Musik und darstellende Kunst in die Dirigierklasse ihres Direktors Alexander von Zemlinsky und in die Kompositionsklasse Fidelio F. Finkes aufgenommen wurde, galt seine pianistische Ausbildung offenbar als abgeschlossen. Nach dem Studium verdingte er sich einige Jahre als Korrepetitor an den Theatern in Brünn (Brno) und Gablonz (Jablonec nad Nisou), bevor er sich als freischaffender Komponist und Theorielehrer in Prag niederließ. Recherchen zu Winterbergs Biographie der Vorkriegszeit haben bisher wenig Aussagekräftiges über sein Wirken als Pianist zutage gefördert. Dass er öffentlich auftrat, geht zumindest aus einer Ankündigung eines Konzertes in der Prager Urania im Dezember 1935 hervor, wo er als Pianist bei der Uraufführung von eigenen Liedern auf Texte von Franz Werfel mitwirkte.
Als Komponist war Winterberg im Vergleich mit den nur wenig älteren Viktor Ullmann und Hans Krása ein Spätzünder. Während Krása und Ullmann bereits mit Anfang 20 mit wichtigen Aufführungen über Wien und Prag hinaus international Karriere machten, trat Winterberg erst mit Mitte 30 als Komponist in die Öffentlichkeit – und dies in sehr überschaubarem und auf Prag beschränktem Maße. Was allerdings nichts über die Qualität seines Komponierens aussagt, aber einer der vielen Gründe ist, warum er erst mit so großer Verspätung wiederentdeckt bzw. überhaupt entdeckt wurde: Er war vor der Epochenzäsur 1939–1945 keine Größe in der Musikwelt, und die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs und der anschließenden Neuordnung Osteuropas führten dazu, dass Winterberg nach dem Krieg – in der Hälfte seines Lebens – mehr oder weniger bei Punkt Null anfangen musste.
Hans bzw. Hanuš wie er sich auf Tschechisch schrieb, wurde am 23. März 1901 in Prag geboren, wuchs als Bürger der k. u. k. Monarchie mit österreichischem Pass auf, wurde tschechoslowakischer Staatsbürger im Oktober 1918, wurde nach dem Anschluss der sogenannten "Resttschechei" durch Nazi- Deutschland im März 1939 aufgrund seiner jüdischen Abstammung zum Staatenlosen, nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager Theresienstadt im Mai 1945 wieder zum Tschechoslowaken, durch seine Übersiedlung nach München 1947 wieder zum Staatenlosen und dann zum "Volksdeutschen", durch seine zweite Ehe 1950 schließlich zum Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Dass es keinen Sinn ergibt, in seiner Musik eine eindeutige nationale "Identität" zu suchen, dürfte auf der Hand liegen.
Obwohl Winterberg bei den bedeutendsten Lehrern Prags in den 1920er und 30er Jahren studiert hatte, bezeichnete er sich in einem Fragebogen, den Heinrich Simbriger 1955 an Komponisten verteilte, die aus den ehemaligen "deutschen Ostgebieten" stammten, als Autodidakt. Und als Vermittler zwischen den Kulturen und Zeiten: "Da ich bis zu meinem 46sten Lebensjahre bis auf unwesentliche Ausnahmen in Prag, meiner Geburtsstadt verbrachte, wäre es natürlich sehr verwunderlich, wenn das slawische Element auf meine künstlerische Produktion nicht abgefärbt hätte. Dies zeigt sich neben Spuren ostischer Folklore vor allem in rhythmischen Momenten. Doch sind diese Elemente durchsetzt von einer Harmonik, die durchaus westischen Ursprungs ist, ich meine dies natürlich im weitestgehenden Sinne. (…) Wenn meine Kompositionen in Zukunft vielleicht mehr beachtet werden, so werden sie eine Art Brücke zwischen der Westkultur (also auch der deutschen) und der des Ostens bilden. (…) Im Allgemeinen bin ich wohl der typische Übergangsmusiker."
Da Winterberg über die Aufführungen und Rundfunkübertragungen seiner Stücke nach seiner Übersiedlung nach München 1947 genau Buch führte und sich zu keiner seiner Klaviersonaten ein Eintrag findet, kann man davon ausgehen, dass diese zu seinen Lebzeiten nicht öffentlich gespielt wurden und dass Christophe Sirodeau und Brigitte Helbig bei ihren Recitals in den letzten Jahren die ersten beiden Klaviersonaten coram publico zur Uraufführung brachten und Jonathan Powell die letzten drei. Wie Powell in seiner folgenden Einführung in das Sonatenschaffen Winterbergs anmerkt, lässt sich Winterbergs Zyklus als organisches Ganzes verstehen. Unmittelbare Echos auf die tragischen Ereignisse in der tschechisch-österreichisch- deutschen Geschichte, wie wir sie in Janáčeks Klaviersonate "1. X. 1905" finden oder in Karel Bermans Suite Reminiscences, hören wir in Winterbergs Klaviersonaten nicht. Gleichzeitig aber sublimieren sie die ungeheuren Spannungen einer Epoche, die sich in der Menschheitskatastrophe des Zweiten Weltkriegs und der Shoah entluden und sind Zeugnis einer faszinierenden Begabung zur Synthese.
Ausführliche Informationen zu Winterbergs Biographie finden sich auf der Website seines Verlags www.boosey.com/winterberg, im Winterberg-Blog auf der Website seines Enkels www.kreitmeir.de, im Blog des Musikwissenschaftlers Michael Haas www.forbiddenmusic.org, auf der Website des Exilarte Zentrum der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien www.exilarte.org und in den Essays zu den weiteren Winterberg-Produktionen auf dieser Website (EDA 51, EDA 53).
Frank Harders-Wuthenow, März 2025
Diese Einspielung der wiederentdeckten Klaviersonaten von Hans (bzw. Hanuš) Winterberg stellt eine Momentaufnahme dar: nicht nur der lebendigen Musikkultur der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit – eine Epoche, in der eine große und verwirrende Menge neuer Musik aus ganz Europa in Prag rezipiert wurde –, sondern auch der außergewöhnlichen stilistischen Reise eines Komponisten, die im relativ kurzen Zeitraum von nur 14 Jahren stattfand.
Ein kurzer historischer Abriss soll die Entwicklung der Gattung Sonate in der tschechischen Musik bis zu diesem Zeitpunkt etwas beleuchten. Nach dem Erscheinen des monumentalen Zyklus von 34 Sonaten von Jan Ladislav (oder Václav) Dusík (oder Dussek), deren letzte, einflussreiche (z.B. für Beethoven) und originelle in seinem Todesjahr (1812) entstanden, erlebt die Gattung eine Art Hiatus, da die tschechischen Komponisten ihr für den Rest des 19. Jahrhunderts kaum noch Interesse entgegenbrachten. Smetanas einziger Beitrag war ein jugendliches – allerdings auch sehr wirkungsvolles – Werk, das er 1846 im Alter von 22 Jahren schrieb, während sich Dvořák eines Beitrags zur Gattung ganz enthielt. Fibichs Liebe zur Klavierminiatur erklärt seine Zurückhaltung gegenüber umfangreicheren Werken für da Instrument. Erst die nachfolgenden Generationen waren der Gattung gegenüber wieder aufgeschlossener: Vitězslav Novák schrieb seine kraftvolle Sonata eroica im Jahr 1900. Und man könnte meinen, dass sein Zyklus Pan (1910) eine kaum verhüllte Symphonie für Klavier solo darstellt, den er tatsächlich ein paar Jahre später auch sehr effektvoll orchestrieren sollte. Josef Suk war zwar ein recht produktiver, höchst origineller Komponist von Klavierwerken, hat aber keine Sonate geschrieben. Weitere Beispiele aus der Spätromantik sind die beiden Sonaten von Otokar Jeremiáš (1892–1962) und die vier von Václav Kaprál (1889–1947). Obwohl diese beiden Komponisten wesentlich jünger als Janáček waren, ist ihre Sprache sehr viel stärker im 19. Jahrhundert verwurzelt und damit Welten von der Nüchternheit von dessen Sonate "1. X. 1905" entfernt. Eine der ungewöhnlichsten Sonaten eines tschechischen Komponisten im spätromantischen Idiom, die für unsere Betrachtung von Winterberg besonders relevant ist, ist die von Winterbergs späterem Lehrer Alois Hába. Sie verströmt eine eindeutig wienerische Atmosphäre und erinnert an den frühen Schönberg, an Zemlinsky und gelegentlich auch an Schreker. Bekanntlich wandte sich Hába bald von diesem Stil ab, fasziniert von Schönbergs athematischem Ansatz in Erwartung und – mit nachhaltigem Einfluss auf sein Schaffen – von Mikrotonalität. Ein weiteres Übergangswerk ist die virtuose Sonate op. 7 (1917) von Boleslav Vomáčka. Sie besteht aus einem einzigen durchgehenden Satz und orientiert sich in der Faktur an der französischen Musik der Epoche. Passenderweise ist sie Blanche Selva gewidmet, die das Werk in Prag uraufführte. Auch Jaromir Weinbergers Sonaten, alle drei Jugendwerke, die vor 1918 entstanden, sind in unserem Zusammenhang von Interesse, weil sie – vor allem die 3. – zeigen, wie stark Debussy von dieser jungen Generation böhmischer Komponisten rezipiert wurde. Dieser Überblick wäre unvollständig ohne die Beiträge von Emil Axman (1887–1949) und Vitězslava Kaprálová. Deren Sonata romantica repräsentiert zwar noch nicht den reifen Stil ihrer meisterhaften Dubnová preludia (April-Präludien), erntete nach ihrer Uraufführung in Brünn 1934, ein Jahr nach der Fertigstellung des Werks, doch nachhaltiges Lob.
Im zweiten und dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war es in erster Linie der Komponist und Dirigent Alexander von Zemlinsky, der das Prager Publikum mit zeitgenössischer Musik vertraut machte. Er leitete von 1911 bis 1927 das Neue Deutsche Theater und war dort auch für die Symphoniekonzerte zuständig. Zu den bemerkenswertesten musikalischen Ereignissen in seiner Prager Ägide gehört die Uraufführung von Schönbergs Erwartung 1924, etwa 15 Jahre nach der Fertigstellung des Werks. Zemlinsky brachte auch Opern von Hindemith, Schreker und Dukas im Neuen Deutschen Theater zur Aufführung, Schönbergs Gurre-Lieder, Bergs Wozzeck und seine eigene Lyrische Symphonie. 1922 gründete er eine Prager Zweigstelle des ursprünglich von Schönberg 1918 in Wien ins Leben gerufenen Vereins für musikalische Privataufführungen; die Organisation hatte etwa 400 Mitglieder und florierte einige Jahre lang, bevor ihre Aktivitäten eingestellt wurden. In Prag vermischten sich in dieser Zeit die Einflüsse der Wiener (anfangs) und der französischen Musik (etwas später) mit einer einheimischen Sprache (insbesondere der Janáčeks), was einen besonders fruchtbaren Boden bereitete für die tschechischen Komponistinnen und Komponisten in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus. Martinů berichtete, dass er Debussys Pelléas et Mélisande zum ersten Mal im Neuen Deutschen Theater erlebte, und dass dieses Werk einen großen Einfluss auf ihn ausübte. Als Geiger der Tschechischen Philharmonie hatte er 1919 eine Europatournee unternommen und dabei viele Eindrücke von den Werken zeitgenössischer Komponisten gesammelt, deren Ideen er – in seinen frühen Stil amalgamiert – in die Heimat zurückbrachte. Ab 1923 lebte er in Paris und schloss Freundschaft mit Komponisten wie Roussel und stand stilistisch "Les Six" nahe. Später wurde seine Musik in der kommunistischen Tschechoslowakei nicht aufgeführt, da er sich geweigert hatte, die Leitung des Prager Konservatoriums zu übernehmen. Martinůs Einfluss auf die tschechische Musik vor und nach dem Zweiten Weltkrieg darf jedoch nicht unterschätzt werden; ungeachtet seiner Übersiedlung nach Frankreich hielt er engen Kontakt zu tschechischen Kollegen. Seine beeindruckende Klaviersonate stammt aus dem Jahr 1957, fast ein Jahrzehnt nachdem Winterberg seinen letzten Beitrag zu dieser Gattung komponiert hatte.
Zemlinsky war jedoch bei weitem nicht die einzige treibende Kraft der neuen Musik in Prag in den 1920er Jahren. Die Internationale Gesellschaft für zeitgenössische Musik (ISCM) veranstaltete sowohl 1924 als auch im darauffolgenden Jahr ihr alljährliches Festival in Prag (gemeinsam mit Paris), und man kann davon ausgehen, dass Winterberg einige der Konzerte besucht hat. Dort kamen vor allem neue Werke aus der Feder von Komponistinnen und Komponisten aus ganz Europa zur Aufführung, die in der Tschechoslowakei zuvor nicht zu hören waren – es waren bedeutsame Ereignisse, die den Horizont des musikinteressierten Publikums und insbesondere der jungen tschechischen Avantgarde erheblich erweiterten. Es kann also kaum überraschen, dass die Sonaten, die tschechische Komponisten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schrieben, einen ganz anderen Charakter hatten nach einem solchen Zustrom unterschiedlicher Einflüsse als ihre Vorgänger. Die Sonate von Karel Jirák (1926) wurde von der Wiener Universal Edition (UE) veröffentlicht, dem führenden Verlag für zeitgenössische Musik im deutschen Sprachraum – sicherlich ein Zeichen für die wachsende Anerkennung der tschechischen neuen Musik in dieser Zeit. Es gibt mehrere interessante Aspekte in dem Werk, die mit Winterbergs kompositorischer Praxis in Verbindung gebracht werden können: Der erste Satz enthält volkstümliche Melodien in der rechten Hand, die von tonal mehrdeutigen Ostinati unterlegt sind, die sich oft zu geradezu orchestralen Steigerungen aufbauen. Der zweite Satz beginnt – wie auch die der meisten Sonaten Winterbergs – mit einer weit ausholenden melodischen Linie, die von parallelen Quint- und Dominantakkorden in tiefer Lage unterbrochen wird. Der letzte Satz ist eine energiegeladene Burleske im 2/2-Takt, die häufig von 3/4- und 5/4-Takten unterbrochen wird und im Charakter einige der Finalsätze von Winterbergs Sonaten vorwegnimmt.
Zu den weiteren bemerkenswerten Sonaten tschechischer Komponisten, die etwa zeitgleich mit Winterbergs Zyklus entstanden sind oder kurz davor, gehört die von Erwin (Ervín) Schulhoff (1918). Sie ist voller Ostinati, posttonaler Chromatik und Synkopen, wobei der erste Satz auf einem langen Orgelpunkt in der Art von Winterbergs erster Sonate endet. Außerdem überlagern sich im ersten Satz Motivwiederholungen unterschiedlicher Länge, ein Mittel, das Winterberg bis an seine Grenzen ausreizen sollte. Karel Reiners Sonate von 1931 ist seinem (und Winterbergs künftigem Lehrer) Alois Hába gewidmet und zeigt den unverkennbaren Einfluss Schönbergs. Weitere bemerkenswerte Beispiele sind Werke von Vladimír Polívka (1932), Jaroslav Ježek (1941) und Jaroslav Doubrava (1948/9). Zu beachten ist auch, dass tschechische Komponisten nicht nur Klaviersonaten schrieben, sondern auch eine Vielzahl kürzerer Stücke und Zyklen. Die rhythmischen Strukturen in der Pastorale, dem 4. Satz der außergewöhnlichen Suite (1935) des Janáček-Schülers Pavel Haas, weist deutliche Parallelen zu Winterbergs Stil auf – eine Figur aus drei Sechzehntelnoten steht einer aus vier Sechzehntelnoten gegenüber, wobei die Akzente auf unerwarteten Zählzeiten liegen. Gideon Klein (1919–1945) war ein viel jüngerer Kommilitone von Winterberg Ende der 1930er Jahre in der Klasse von Alois Hába am Prager Konservatorium. Er schrieb seine Klaviersonate 1943 im Ghetto Theresienstadt. Es gibt einige Gemeinsamkeiten mit den Sonaten Winterbergs, vor allem in Bezug auf die gesättigte chromatische Harmonik, die rhythmische Energie, die Verwendung von Ostinati (vor allem in den langsamen Sätzen) und die fehlende Scheu vor der Verwendung spätromantischen Klaviersatzes im Kontext einer modernistischen Sprache.
Viktor Ullmann ist der einzige andere tschechische Komponist, dessen Zyklus von Klaviersonaten in Umfang, Originalität und Beherrschung der kompositorischen Mittel mit derjenigen von Winterberg vergleichbar ist. Seine erste Sonate stammt – wie die erste Winterbergs – aus dem Jahr 1936. Sie verbindet eine Wiener Ausdrucksintensität (der zweite Satz trägt den Untertitel "in memoriam Gustav Mahler") mit der für die tschechische Musik typischen rhythmischen Eigensinnigkeit und liedhaften Thematik, angereichert mit einigen Einsprengseln Skrjabinscher Harmonik und durchsichtigen, fast impressionistischen Texturen. Wie die meisten der sieben Sonaten Ullmanns sowie die oben erwähnten Werke seiner Zeitgenossen ist sie dreisätzig. Winterberg verwendete die dreisätzige Form ebenfalls in seinen ersten drei Sonaten, in den zwei letzten geht er über zu einer viersätzigen Anlage. Im Vergleich zu seinen vier Klavierkonzerten – komponiert zwischen 1948 und 1974 – und den sieben Klaviersuiten – entstanden zwischen 1927 und den 1960er Jahren (die seiner vierten Frau Luise Maria gewidmete Impressionistische Klaviersuite lässt sich nicht genau datieren) – entstanden sie in dem relativ kurzen Zeitraum von 14 Jahren.
Im Verlauf der fünf Sonaten können wir die folgenden binären Tendenzen beobachten, wobei sich Winterbergs Ansatz von einer vielleicht typischen modernistischen Haltung der 1920er und 30er Jahre (Dunkelheit, Komplexität, Fragmentierung, Kontrast, Intensität des Ausdrucks, Atonalität) hin zu einer neuen Sprache der Nachkriegszeit entwickelt (Klarheit, Einfachheit, Stabilität, Kontinuität, Gleichgewicht und tonale/posttonale Harmonik), die trotz aller Veränderungen immer noch Spuren ihrer stürmischen Wurzeln aus dem vorangegangenen Jahrzehnt aufweist.
Diese Transformationen lassen sich in fünf Hauptkategorien einteilen:
i. Dunkelheit — Licht/Klarheit
ii. Komplexität — Einfachheit
iii. Scharfe Kontraste/Zersplitterung/schnelle Wechsel — Kontinuität/Stabilität
iv. Intensiver Ausdruck/starke Emotion — innere Ruhe/Gleichgewicht
v. atonal — post-tonal
Hört man alle fünf Sonaten ohne Unterbrechung hintereinander, wird deutlich, wie diese Prozesse ineinander verschränkt sind, – eine ähnliche Erfahrung macht man mit den letzten fünf Sonaten von Beethoven oder denen von Skrjabin. Eine Skizze der wichtigsten Merkmale jeder Sonate (und vor allem ihrer ersten Sätze) soll diesen Prozess zusätzlich verdeutlichen:
Sonate Nr. 1 rasche Stimmungsschwankungen, rauschhaft-ungestüm
Sonate Nr. 2 muskulös, starke dynamische Kontraste
Sonate Nr. 3 obsessives moto perpetuo, dunkles Pulsieren
Sonate Nr. 4 lyrisch, ausladend, romantische Virtuosität
Sonate Nr. 5 pastorale, friedliche Stimmung, die sich über lange Abschnitte erstreckt, rauschhaftkontemplativ
Im Laufe von etwas mehr als einem Jahrzehnt verfeinerte Winterberg einen subtilen Ansatz der Synthese verschiedener Einflüsse, denen er während des explosionsartigen Aufbruchs der Neuen Musik im Prag der 1920er und 1930er Jahre ausgesetzt war. Zunächst bewunderte er die Zweite Wiener Schule (wovon seine erste Klaviersuite von 1927 eindrucksvoll Zeugnis ablegt), dann assimilierte er Aspekte des französischen Impressionismus, schließlich geriet er – spätestens in seiner Zeit als Korrepetitor am Theater in Brünn – in den Bann des Spätwerks von Janáček. Natürlich mag jeder Hörer, der diesen faszinierenden Werken zum ersten Mal begegnet, auch andere Einflüsse spüren – Hindemith, vielleicht Busoni (vor allem im ersten Satz der fünften Sonate) und Skrjabin; aber letzten Endes man kann über ihren Erfindungsreichtum nur staunen und beglückt sein über ihre Wiederentdeckung.
Jonathan Powell, März 2025
